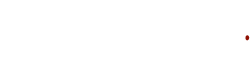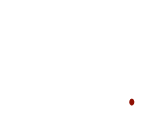In naturnahen Gärten herrscht aktuell reger Flugbetrieb: Kohl- und Blaumeisen, Amseln, Buchfinken, Rotkehlchen und Spechte suchen im Gras, an Büschen und Bäumen nach Leckerbissen und machen Stippvisiten an Futterstellen. Viele naturbegeisterte Menschen fragen sich: Soll ich die Gartenvögel jetzt schon füttern, womit und wie? NABU-Ornithologe Stefan Bosch hat Antworten auf fünf zentrale Fragen rund um die Vogelfütterung im Herbst und Winter.
Zusammengefasst
- Vögel im Winter füttern ist eine bezaubernde Beschäftigung, die insbesondere Körnerfressern hilft.
- Beliebtes Futter sind Sonnenblumenkerne, Meisenknödel und frische Früchte, kein Brot oder Speisereste.
- Silo-Futterspender sind am besten; sie schützen das Futter vor Witterung und Schmutz.
- Vogelfütterung unterstützt den Artenschutz nur bedingt; abwechslungsreiche Lebensräume sind entscheidender.
- Die Fütterung startet idealerweise zwischen November und Ende Februar, besonders bei Kälte und Frost.
Soll ich im Winter überhaupt füttern?
„Ja, Vögel füttern macht Spaß und schafft während der kalten Jahreszeit ein tolles Naturerlebnis direkt im eigenen Garten und auf dem Balkon. Es hilft jedoch nur häufigen Arten und meistens den Körnerfressern“, sagt NABU-Vogelexperte Stefan Bosch. Das große Flattern am Futtersilo begeistert auch Kinder. Damit immer was los ist, sollte regelmäßig aufgefüllt werden. „Vögel sind bekanntlich mobil, sie fliegen stets dorthin, wo das leckerste Futter auf sie wartet“, so Bosch.
Welches Futter schmeckt welchem Vogel?
Sonnenblumenkerne, auch geschält, sind ein gutes Basisfutter und bei vielen Arten beliebt. Körnerfresser, wie Finken, Sperlinge und Meisen, mögen auch Mischungen mit verschiedenen Körnern und Samen. Meisenknödel bestehen aus Samen und Fett. Sie sollten in einem extra Knödelspender aufgehängt werden statt im Plastiknetz. Äpfel, Rosinen und Haferflocken oder Weichfuttermischungen lieben Amseln und Rotkehlchen. Wichtig ist, keine Speisereste oder Brot anzubieten, sondern nur trockenes und frisches Futter. Wer das Vogelfutter nicht im Fachhandel, sondern im Bau- oder Gartenmarkt besorgt, sollte auf eine Empfehlung der Naturschutzverbände achten sowie möglichst „Bio“ und regional kaufen. Die Körner müssen frei von Samen der Allergien auslösenden Ambrosia-Pflanze sein.
Welcher Futterspender ist der beste und wo kommt er hin?
Eine saubere Sache sind Silo-Futterspender, die sich leicht in Ordnung halten und auffüllen lassen. Die Körner sind darin vor Kot, Wind und Wetter besser geschützt als im offenen Futterhäuschen. Den Futterspender hängt man unerreichbar für Katzen auf, in der Nähe von Bäumen oder Büschen als Rückzugsmöglichkeit. Am besten wettergeschützt unterm Dach, mit ausreichend Abstand zu Glasscheiben, damit die Vögel nicht dagegen fliegen. Damit sich unter dem Futterspender kein Dreck sammelt, kann man ab und zu den Standort wechseln. Ein klassisches Vogelhäuschen muss täglich ausgefegt und alle ein bis zwei Wochen mit heißem Wasser und Bürste gereinigt werden. So haben Krankheitskeime kaum Chancen, sich unter den Vögeln auszubreiten.
Hilft die Vogelfütterung dem Artenschutz?
Leider nein, denn für eine artenreiche Vogelwelt braucht es in ganz Baden-Württemberg natürlich wachsendes Vogelfutter. Nur etwa zehn bis 15 häufige Arten nutzen das Futterstellen-Buffet, in der Regel sind keine gefährdeten darunter. Besonders wichtig sind deshalb Brachflächen in der Feldflur, naturnahe Grünflächen und Gärten sowie ein artenreicher Mischwald. „Wo es eine Vielfalt an Futterquellen gibt, steckt das pure Leben. Hier finden sich Lebensräume für Raupen, Würmer, Schmetterlinge und Käfer – und auch Vögel werden satt“, betont Bosch. „Pflanzen Sie regionale Sträucher, die im Winter Früchte tragen, lassen sie eine Wiese wachsen und das Laub auf Beeten und unter Sträuchern liegen, damit Vögel sich ihr Futter dort selbst suchen können“, rät der NABU-Vogelexperte.
Wann starte ich mit dem Vogelfüttern?
„Klassischerweise ist etwa zwischen November und Ende Februar die Futterstelle eröffnet“, sagt Bosch. Am besten füttert man dann, wenn es wirklich kalt ist und Frost sowie Schnee die Futtersuche erschweren. „Nach einem Kälteeinbruch kommen oftmals verstärkt Vögel ans Futterhaus und es lassen sich die ersten Wintergäste aus dem Norden, wie der Erlenzeisig, beobachten“, erklärt der Ornithologe. Wenn Felder abgeerntet und Wiesen gemäht sind, finden Vögel in der Natur weniger Futter. Können sie sich am Futtersilo satt fressen, sparen sie Energie.
Quelle: NABU – Naturschutzbund Deutschland e.V.