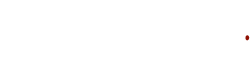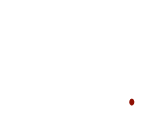Die Sanierung wird durch finanzielle Unterstützung und Finanzpuffer bezahlbar und planbar.
Qualität hat ihren Preis: Hochwertige Materialien, professionelle Ausführung und Kontrollen verhindern kostspielige Mängel.
Durch eine energetische Sanierung kann man den Wert einer Immobilie steigern, den Wohnkomfort verbessern und den Energieverbrauch reduzieren. Allerdings kann sie, wenn sie nicht richtig umgesetzt wird, ihre Effizienz verlieren und im schlimmsten Fall teure Schäden verursachen, anstatt einen Wertzuwachs zu erzielen. Viele Projekte scheitern wegen typischer Fehler.
Eine Sonderveröffentlichung mit freundlicher Unterstützung durch:



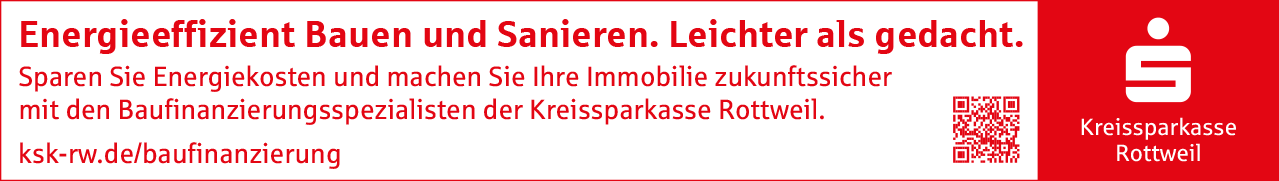


Um zu verhindern, dass Hausbesitzer während der energetischen Sanierung auf Stolperfallen geraten, hat der Architekt Sven Haustein von Schwäbisch Hall die fünf häufigsten Fehler aufgezeigt und gibt Tipps, wie man sie von Anfang an vermeiden kann.
1. Sanierung ohne Konzept
Voller Tatendrang beginnen viele Hausbesitzer, ohne zuvor den Zustand des gesamten Gebäudes zu analysieren und ohne einen Gesamtplan. Sven Haustein warnt: „Ohne ein durchdachtes Konzept zur Sanierung laufen die einzelnen Schritte Gefahr, nicht optimal aufeinander abzustimmen zu sein, was zur Folge haben kann, dass die Maßnahmen letztlich wirkungslos sind.“
Oft ist das Problem mangelnde Planung oder Modernisierer scheuen sich vor dem bürokratischen Aufwand. Das kann zusammen mit impulsiven Entscheidungen oder Wissenslücken schnell zu ineffizienten Ergebnissen oder sogar zu Schäden am Gebäude führen. Die Antwort: ein Sanierungsfahrplan mit Struktur. „Ein Konzept, in dem alle Maßnahmen sinnvoll aufeinander aufbauen, entsteht mit Hilfe eines Energieberaters oder Bausachverständigen“, erklärt Haustein.
Modernisierungsberater bieten ihre Hilfe für einen ersten Gebäudecheck an und stellen den Kontakt zu Handwerkern und Energieexperten in der Region her. Der doppelte Vorteil: Ein effektiver Sanierungsfahrplan legt nicht nur eine sinnvolle Reihenfolge der Arbeiten fest, sondern identifiziert auch frühzeitig mögliche Baumängel oder Altlasten. „Risse im Mauerwerk oder Asbestfunde können so gleich in die Planung und Kostenkalkulation einfließen“, sagt Haustein.
2. Renovieren ohne finanziellen Puffer
Oftmals unterschätzen Eigentümer die realen Kosten oder sparen an den falschen Stellen. „Selten laufen Sanierungsprojekte ohne Probleme. „Unerwartete Zusatzarbeiten gehören fast immer dazu“, erklärt Architekt Sven Haustein. Ohne finanziellen Spielraum werden solche Überraschungen schnell problematisch.
Im schlimmsten Fall können Baustopps, Qualitätsmängel oder kostspielige Nachbesserungen die Folge sein. Hausteins Rat: Ein Puffer von zehn bis 20 Prozent der Gesamtkosten ist empfehlenswert. „Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen und diese nicht nur nach dem Preis, sondern auch nach Leistungsumfang und Qualität zu vergleichen.“
3. Renovierung ohne finanzielle Unterstützung
Viele Hausbesitzer nutzen Fördermittel nicht und verschenken damit Geld. Zuschüsse und zinsgünstige Kredite können die Finanzierung erheblich erleichtern. „Egal ob Klein- oder Großprojekt, Fördermittel sind oft der entscheidende Faktor“, ergänzt Haustein.
Die Förderlandschaft ist jedoch schwer zu überblicken und der bürokratische Aufwand schreckt ab. Ohne Energieberatung zu starten oder die Fördervoraussetzungen nicht zu prüfen, kann dazu führen, dass man leer ausgeht. Denn die Programme der KfW und der BAFA verlangen beispielsweise eine Energieberatung vor Beginn der Sanierungsmaßnahmen. Seinen Ratschlag: Eine qualifizierte Energieberatung sollte man schon in der Planungsphase nutzen und alle relevanten Förderprogramme prüfen lassen. Haustein empfiehlt, alle relevanten Förderprogramme prüfen zu lassen und schon in der Planungsphase eine qualifizierte Energieberatung in Anspruch zu nehmen. Es ist ratsam, die Antragstellung über einen Energieberater zu machen – er weiß genau, welche Fristen und Anforderungen gelten. „Es ist wichtig, dass jeder, der eine Sanierung plant und bereits eine Energieberatung in Anspruch genommen hat, die aktuell verfügbaren Fördermöglichkeiten nutzt. „Die Hoffnung auf bessere Förderungen in der Zukunft war bisher selten sinnvoll“, meint der Architekt.
4. Renovieren mit falschen Materialien
Es gibt viele Fallstricke, wenn es um die Auswahl von Materialien geht. In der Hoffnung, kurzfristig Kosten zu sparen, wählen manche Eigentümer günstige Baustoffe oder setzen auf moderne Materialien, die nicht zum Zustand ihres Hauses passen.
„Besonders bei älteren Gebäuden kann man mit ungeeigneten Materialien langfristig mehr schaden als nützen“, warnt der Fachmann. Wer auf geprüfte Qualität, Gütesiegel und professionelle Beratung vertraut, kann sich sicher fühlen. „Die Auswahl der Materialien sollte zur Bausubstanz und zum Nutzungskonzept passen, wie z.B. diffusionsoffene Baustoffe. Andernfalls ist der nächste Bauschaden schon vorprogrammiert, so Haustein.
5. Renovieren, ohne zu überwachen
Eine Sanierung kann selbst mit guter Planung und hochwertigen Materialien scheitern, wenn die Ausführung nicht regelmäßig kontrolliert wird. Viele Sanierer verlassen sich komplett auf die Handwerksbetriebe und merken nicht, dass selbst erfahrenen Profis Fehler passieren können. „Oft erkennt man Baumängel erst, wenn alles fertig ist, und dann wird es teuer, sie nachzubessern“, erklärt der Experte.
Die Antwort: Eine erfahrene Bauüberwachung von Anfang an einplanen. Unabhängige Sachverständige oder Energieberater sollten die Arbeiten regelmäßig überprüfen und dokumentieren. „Eine energetische Sanierung ist eine Zukunftsinvestition – aber nur, wenn sie sorgfältig geplant und richtig umgesetzt wird. „Wer mit Struktur, fachlicher Beratung und einem Fokus auf Qualität an die Sache herangeht, der spart langfristig Geld, Energie und Nerven.“

Bildquelle: Zukunft Altbau
CO2-Vermeidung beim Sanieren maximieren: Das sind die wichtigsten Faktoren
Was man über Dämmstoffe und die Bausubstanz wissen sollte
Eine energetische Sanierung senkt die Heizkosten und erhöht den Wohnkomfort. Viele Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer wollen so auch klimafreundlicher leben. Neben dem Umstieg auf Heizungen mit erneuerbaren Energien ist die Dämmung eine wichtige Maßnahme, um die Kohlendioxid-Emissionen zu senken.
Naturnahe Dämmstoffe gelten hier als umweltfreundlichere Alternative zu konventionellen Materialien wie Polystyrol. Ein deutlich geringerer Energieaufwand bei ihrer Herstellung ist im Vergleich zu konventionellen Dämmmaterialien jedoch nicht immer garantiert. Grundsätzlich gilt: Der weitaus wichtigere Hebel für die CO2-Einsparung ist, bei der Sanierung die vorhandene Bausubstanz zu erhalten, insbesondere massive Wände und Stahlbetondecken. Damit vermeidet man besonders viel CO2-Emissionen.
Ein wichtiges Element für ein klimafreundliches Wohnen sind die Dämmung von Fassade, Dach und Kellerdecke. Es gibt dafür drei Kategorien von Dämmmaterialien: Synthetische Dämmstoffe, die meist auf Basis fossiler Rohstoffe hergestellt werden, mineralische Dämmmaterialien und naturnahe Dämmstoffe aus überwiegend nachwachsenden Rohstoffen. Zu den Dämmmaterialien auf Basis fossiler Rohstoffe gehören etwa Polyurethan, Polystyrol oder Phenolharz. Stein- oder Glaswolle sind Beispiele für mineralische Dämmstoff, Holzfaser- oder Zellulosedämmungen Beispiele für naturnahe Dämmstoffe. Es gibt aber auch Dämmmaterialien aus Hanffasern, Stroh und Seegras.
Naturnahe Dämmstoffe enthalten meist Zusatzstoffe
Zu beachten ist: Fast alle dieser grundsätzlich positiv zu bewertenden naturnahen Dämmstoffe enthalten Additive. „Das sind Zusatz- und Hilfsstoffe zur Verbesserung der baulichen Eigenschaften wie dem Brandschutz“, erklärt Frank Hettler von Zukunft Altbau. „Zum Ende der Lebensdauer wird es dadurch erheblich erschwert, naturnahe Dämmstoffe einfach in natürliche Kreisläufe zurückzuführen. Daher müssen sie aktuell ähnlich wie andere Dämmstoffe fachgerecht entsorgt werden.“
Materialien auf Basis fossiler Rohstoffe und mineralische Dämmstoffe sind bisher mit über 80 Prozent Marktanteil am weitesten verbreitet, da sie in der Regel günstigster sind und sehr gute Dämmwerte besitzen. Gegenüber naturnahen Dämmstoffen ist bei ihnen eine geringere Dämmstärke notwendig, um dieselbe Dämmwirkung zu erzielen. Stofflich zu verwerten oder einfach zu recyceln sind diese Dämmstoffe jedoch zum Großteil auch nicht.
Auch wenn das Recyceln noch Herausforderungen birgt: Durch die Dämmung von Gebäuden wird viel mehr CO2 eingespart, als für die Herstellung der Dämmstoffe nötig ist. Je nach Dämmstoff und Heizungsart amortisiert sich der CO2-Ausstoß innerhalb von maximal zwei Jahren. Betrachtet man beispielsweise ein Haus mit 140 Quadratmetern Wohnfläche, verursacht die Produktion von Dämmplatten aus Polystyrol (EPS) knapp sechs Tonnen CO2-Ausstoß. Über die Lebensdauer der Dämmung wird ein Mehrfaches dieses CO2-Ausstoßes wieder eingespart.
Alle Dämmmaterialien tragen zu klimafreundlicheren Gebäuden bei und sind unverzichtbar zur Dekarbonisierung des Gebäudesektors. Gebäude ohne eine zumindest teilweise gedämmte Außenhülle dagegen verschwenden erhebliche Mengen an Energie. Bei ihnen geht ein Mehrfaches der für die Dämmung notwendigen Erzeugungsenergie über Schornsteine und Außenhüllen verloren. Selbst wenn sie mit erneuerbaren Energien versorgt werden, ist die Effizienz schlecht und damit die Energiekosten hoch – auch wenn der CO2-Ausstoß niedrig ist. Gänzlich ungedämmte Gebäude sind langfristig daher nur in Ausnahmefällen vertretbar.
Alte Bausubstanz weiternutzen
Wichtig zu wissen: Den CO2-Ausstoß reduziert man besonders stark, wenn bei einer energetischen Sanierung die vorhandene Bausubstanz erhalten bleibt. Das gilt vor allem für massive Wände und Stahlbetondecken. Für die Errichtung eines Einfamilienhauses mit 140 Quadratmetern Wohnfläche belaufen sich die Emissionen auf rund 65 Tonnen CO2 – rund zehnmal soviel, wie für die Dämmung mit EPS anfällt. Saniert man ein Bestandgebäude und nutzt man die massiven Bauteile weiter, fällt dieser CO2-Ausstoß erst gar nicht an.
Der Erhalt der Bausubstanz vor allem beim Rohbau ist daher besonders wichtig. Das spart wertvolle Rohstoffe und viel Energie. „Es ist beispielsweise nicht nachhaltig, einen Altbau abzureißen und den Neubau aus Beton mit einer Hanfdämmung zu versehen“, sagt auch Birgit Groh vom Deutschen Energieberater-Netzwerk (DEN). „Denn zur Erstellung des neuen Gebäudes wird viel mehr graue Energie benötigt, als eine auf naturnahen Baumaterialien basierte Dämmung einspart.“
Graue Energie ist die Energiemenge, die für Herstellung, Transport, Verarbeitung und Entsorgung von Baustoffen anfällt. Selbst bei einem Neubau aus Holz dauert es Jahrzehnte, um aus ökologischer Sicht die Vorteile eines weiter genutzten Gebäudebestands mit guter Dämmung und erneuerbarer Wärmeerzeugung einzuholen. Aus Klimaschutzsicht bleiben allerdings ungedämmte Bestandsgebäude mit schlechter Energiebilanz und Öl- und Gasheizungen die größten Umweltsünder.
Fazit: Klimaschutz am Bau bedeutet, die vorhandene Bausubstanz weitgehend zu erhalten und den Gebäudeenergieverbrauch mittels der Dämmung der Gebäudehülle zu reduzieren. Das kann grundsätzlich mit allen Dämmmaterialien geschehen. Dazu kommt dann noch die Heizanlage mit erneuerbaren Energien.
Aktuelle Informationen zur energetischen Sanierung von Wohnhäusern gibt es auch auf www.zukunftaltbau.de.