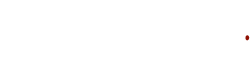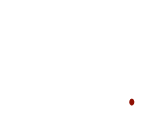Aus Anlass des vor 500 Jahren in weiten Teilen des Heiligen Römischen Reichs gewüteten Bauernkrieges besuchte der Museums- und Geschichtsverein Schramberg das Kultur- und Museumszentrum in Glatt. Dort führten Museumsleiter Cajetan Schaub und Kreisarchivar Johannes Waldschütz eine kleine Gruppe durch die Sonderausstellung zu diesem Thema.
Bewegte Schlossgeschichte
Sulz-Glatt/Kreis Rottweil/Schramberg. Zu Beginn erzählte Schaub etwas zum Schloss selbst, dessen Ursprünge ins 13. Jahrhundert zurückreichen. Durch einen Umbau im Jahr 1533 steigerte Reinhardt von Neuneck (1474-1551) die Wehrhaftigkeit, was als Folge des Bauernkriegs zu sehen ist. Es ist heute „eines der ältesten deutschen Renaissanceschlösser“, betonte Schaub.
Nach dem Aussterben der Herren von Neuneck im 17. Jahrhundert übernahmen kurzzeitig die Freiherren von Landsee, doch bei einem weiteren Umbau sei ihm „das Geld ausgegangen“, so Schaub weiter. 1706 erwarb dann das Kloster Muri in der Schweiz die Herrschaft und hielt sie bis zur Säkularisation 1803. Fortan befand sich das Schloss im Besitz der Hohenzollern, die es 1970/71 an die Gemeinde Glatt verkauften.
Rüstkammer
Zunächst führte Schaub durch die Rüstkammer, die eine Privatsammlung darstellt und auch Waffen aus der Zeit des Bauernkrieges enthält. Ein besonderes Highlight sei eine Ritterrüstung aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts, von der es nur noch eine Handvoll auf der Welt gibt.
Derzeit befinde sich diese noch in Bad Schussenried, wo sie die große Landesausstellung „Uffruhr – Utopie und Widerstand im Bauernkrieg 1524/25“ ergänzte. Museumsleiter Schaub freue sich über die Ausleihe, da sie „Werbung für uns“ sei.
Der Waldhaufen und die zwölf Artikel
An der Sonderausstellung in Glatt seien die beiden Landkreise Rottweil und Freudenstadt sowie die Stadt Sulz beteiligt gewesen. Kreisarchivar Johannes Waldschütz berichtete, dass Oberschwaben lange Zeit als Kernland des Aufstandes galt, aber der Flächenbrand sich auch in unserer Region bemerkbar machte. Dort agierte der sogenannte „Haufen vor Wald“ oder auch „Waldhaufen“ unter der Leitung von Thomas Mayer aus Loßburg.
Ihre Anliegen fassten sie in den „12 Artikeln“ zusammen und verlangten unter anderem die Abschaffung der Leibeigenschaft, freie Pfarrerwahl oder die Senkung der Abgaben und Frondienste. Infolge des Buchdrucks verbreitete sich die Flugschrift, die der Horber Laientheologe Sebastian Lotzer maßgeblich verfasste, in Windeseile.

Doch „wer waren die Aufständischen?“ Dieser Frage gingen die Kuratoren der Ausstellung nach und werteten unter anderem Urfehden aus. Praktikantin Sara Balkau erarbeitete hierzu eine kleine Broschüre. Urfehden sind Rechtsdokumente, in denen Straftäter schwören mussten, nicht mehr aufzubegehren. Sollten sie sich meineidig verhalten, hatte dies schwerwiegende Konsequenzen wie die Todesstrafe oder Verbannung.
Für unsere Region stellten die Kuratoren eine Auflistung der Teilnehmenden auf, in der Name, Herkunftsort, Territorialherr und Handlungsort ersichtlich werden. Sie enthalten allerdings keine Informationen über die zahlreichen Gefallenen, sondern lediglich diejenigen, die ihre Herren wieder in die Freiheit entließen.
Gerade die Leibeigenschaft, die die „stärkste Form der Abhängigkeit“ ausmachte, wie Waldschütz erklärte, veranlasste viele zur Partizipation am Aufstand. Auch Stadtbürger aus sogenannten Ackerbaustädten wie Dornhan und Dornstetten mit wenigen hundert Einwohnern waren beteiligt, da diese für ihr Einkommen ebenfalls Landwirtschaft betrieben und sich mit denselben Problemen beschäftigten.
Aufstand gegen das Kloster Alpirsbach
Der Bauernkrieg war jedoch keine Neuheit, denn schon wenige Jahre zuvor erhoben sich Bauern des Klosters Alpirsbach gegen den dortigen Abt Alexius Karrenfurer im „Armen Konrad“. Dem Söldner Thomas Mayer, der einen der bedeutendsten Höfe in Loßburg bewirtschaftete, gelang es 1525 schließlich die Bauern erneut gegen das Kloster und die Adligen der Region zu mobilisieren. Der Abt und zahlreiche Edelleute flohen nach Rottweil, wo sie teilweise eigene Häuser und das Bürgerrecht besaßen.
Die Bauern wiederum teilten sich auf und zogen gegen Dießen, Kloster Reichenbach, Dornstetten und Dornhan, wo sie Anhänger gewannen, raubten und plünderten. Die Burg Mandelberg bei Bösingen im Landkreis Freudenstadt steckten die Bauern gar in Brand, wie Waldschütz erzählte. Das Kloster Reichenbach hingegen konnte weitgehend verschont werden, da der Schultheiß Brosi Sur von Baiersbronn Schlimmeres verhinderte.
In Dornstetten entstanden sogar eigene Artikel, um verschiedene Rechte einzufordern, die unter anderem die Allmendnutzung der Wälder betrafen. Als „einzige Frau, die in unserem Raum Urfehde geleistet hat“ ist Endlin Murer bekannt. Württemberg entließ sie sogar „als letzte aus dem Gefängnis“, wie Waldschütz berichtete. und verbannten sie dem Territorium, weil sie den reformatorisch gesinnten Pfarrer Heinrich Wölfflin befreite.
Waffenkammern geplündert
Da Bauern „kein zweischneidiges Schwert tragen“ durften, plünderten sie auf ihren Zügen die Waffenkammern insbesondere aus dem Schloss Glatt, aber „konnten die Waffen nicht benutzen“, so Schaub. Auch ein Adliger namens Wolf von Bubenhofen „schloss sich den Bauern an“, erzählte Waldschütz. Er war von seinem eigenen Stand enttäuscht und galt als verarmt.
Reinhardt von Neuneck war später sehr erzürnt über diesen Verrat. Mit diesen Kanonen zog der Haufen nach Sulz, das sie Ende April 1525 einnehmen konnten. Da Sulz „mehr Handels- als Bauernstadt“ war, dauerte die Belagerung länger und die Stadtherren waren den Bauern nicht wohlgesonnen.
Die Bauern blickten „durchaus auf Rottweil“, wohin der Bauernjörg als Anführer des Schwäbischen Bundes allerdings den Weg versperrte, sagte Waldschütz. Die Bauern entschlossen sich nach Norden zu ziehen, wo sie noch die Stadt Herrenberg einnahmen und sich in Böblingen mit weiteren Bauernhaufen vereinigten.
Bei Böblingen geschlagen
In der Schlacht bei Böblingen unterlagen die Bauern den Truppen des Schwäbischen Bundes vernichtend und hatten 3000 bis 5000 Tote zu beklagen. Die Gegenseite nur 40. Der Rädelsführer Thomas Mayer konnte zunächst fliehen, die Truppen nahmen ihn schließlich gefangen und enthaupteten ihn in Tübingen. Damit endete der Bauernkrieg im Wesentlichen in unserer Gegend.
Viele Namen sind nach dem Aufstand aus den Quellen verschwunden, was auf deren Tod hinweist. Die „Urfehden zeigen einzelne Schicksale“, kam Waldschütz auf die Quellengattung zurück. Wer sich meineidig verhielt, galt als vogelfrei, was die Bauern in ein „enges Korsett des Verhaltens“ zwängte, so Waldschütz weiter.

Letztlich gewannen die Herren die Auseinandersetzung, doch „was bleibt vom Bauernkrieg?“ Beiderseitige Angst, aber auch Entgegenkommen, denn, wer seine Bauern zu sehr strafte, der hatte weitere Konflikte zu befürchten. Somit kann das Verhalten nach dem Bauernkrieg ebenso individuell wie dasjenige während des Aufstandes je nach Region beschrieben werden, schloss Waldschütz die Führung.
Nach einem verdienten Applaus und zwei Sitzkissen des Vereins als Dankeschön von Vorsitzender Annette Fuchs fanden noch Gespräche zum Thema statt und die Anwesenden sahen sich die Ausstellung noch genauer an.