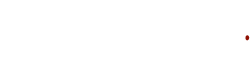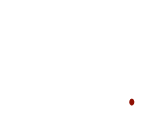Am 19. Juli 1985, heute vor 40 Jahren, wurde im Stadtmuseum Schramberg die Dauerausstellung „Burgengeschichte“ eröffnet – als letzte der insgesamt fünf Dauerausstellungen in der Gründungszeit und als eine der ersten Präsentationen zur Archäologie des Mittelalters und der Frühen Neuzeit in einem Museum in Baden-Württemberg.
Schramberg. Die Ausstellung vermittelt seitdem ein anschauliches Bild der „Burgenstadt“ und zeigt eine Auswahl der Funde der so genannten „Burgpioniere“, die von den 1950er- bis 1980er-Jahren die Burgruinen ihrer Heimatstadt sanierten und dabei auch auf ihr archäologisches Erbe stießen.

Forschung zu Ofenkacheln
Eingerichtet haben die Dauerausstellung der führende Burgpionier Lothar Späth (1941 – 2024) in Zusammenarbeit mit der damaligen Museumsleiterin Gisela Lixfeld und der Volkskundestudentin Bettina von Oppeln. Als ausgebildete Töpferin konnte sie sich bei der großen Fundgruppe „Keramik“ besonders einbringen.

Unter dem Titel „Alte Funde im neuen Licht – Burgenarchäologie in Schramberg“ nahm das Stadtmuseum Schramberg im Jahr 2022 in einem Forschungs-, Ausstellungs- und Buchprojekt mit dem Kurator Moritz Seeburger eine Bestandsaufnahme seiner archäologischen Sammlung vor, deren Objekte in der Fachwelt bereits seit einigen Jahren ein zunehmendes Interesse finden.
Einer dieser Fachleute ist der Archäologe und Kunsthistoriker Harald Rosmanitz, der bereits in den 1980er-Jahren bei seiner Magisterarbeit mit Lothar Späth Kontakt hatte und als Referent bei der Jahrestagung des Förderkreises Archäologie in Baden im Jahr 2024 in Schramberg erneut auf die Funde der Burgpioniere im Schwarzwald aufmerksam wurde.

Ofenkachelexperte arbeitet im Stadtmuseum
Im Lauf der Zeit entwickelte er sich zu einem führenden Spezialisten für Ofenkacheln aus dem Mittelalter und der Frühen Neuzeit, promovierte über das Thema „Ofenkacheln im Spessart – Fallbeispiel Burg Wildenstein und pflegt die größte Datenbank mit mehr als 87.000 Objekten zu diesem Fachgebiet. In der Tradition von Architekten und Bauherren des 15./16. Jahrhunderts bezeichnet er sich als „Furnologe“ und ist mit dem Online-Magazin „Furnologia“ im Internet vertreten.
Beruflich hat er in den letzten zwanzig Jahren beim „Archäologischen Spessartprojekt“ des Unterfränkischen Instituts für Kulturlandschaftsforschung an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg den Fachbereich „Archäologie“ aufgebaut und dabei beispielhaft zahlreiche ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingebunden.

Mehrjähriges Forschungsprojekt
In Kooperation mit dem renommierten Experten geht das Stadtmuseum Schramberg in einem mehrjährigen Forschungs-, Ausstellungs- und Buchprojekt die wissenschaftliche Auswertung der von den Burgpionieren gefundenen Ofenkachel(fragmente) an, der größten Objektgruppe in der Archäologischen Sammlung.
In einem ersten Schritt wurden in der ersten Jahreshälfte bei zwei Besuchen die Objekte im Archäologischen Magazin und in der Dauerausstellung fotografisch erfasst und in die Datenbank aufgenommen. Etwa 200 Objekte wurden darüber hinaus mit einem Streiflichtscanner digitalisiert, um sie plastisch rekonstruieren zu können.
Das „extrem aussagekräftige Material“ erweitert die Kenntnis der Burg und Festung auf dem Schramberg in vielerlei Hinsicht. Einige Halbzylinderkacheln aus dem Spätmittelalter werfen ein neues Licht auf die alte Kontroverse, ob es bereits vor dem Bau von 1457/59 von Hans von Rechberg (+1464) eine Burg gab – und weisen sehr deutlich darauf hin.

Die Burg als Repräsentativbau
Eine große Seltenheit sind Ofenkacheln in Fayencekeramik, die Harald Rosmanitz als das „Meißner Porzellan des 15. Jahrhunderts“ bezeichnet. Eine große Besonderheit war außerdem in der „Königsklasse des Keramikers“ ein vollplastisch gestalteter Kachelofen. Einen der wenigen Kachelöfen dieser Art gab es ab 1550 im Rathaus der Reichsstadt Augsburg – und auf der Hohenschramberg.

Es zeigt sich bei deren genauerer Erforschung immer mehr, dass sie über ihre zeitweilige militärische Bedeutung hinaus mit einer „Tendenz zu Neuschwanstein“ von großer repräsentativer Bedeutung für ihre Eigentümer war. „Da steckt auch sehr viel Kunst, Literatur und höfisches Leben dahinter. Wie bei einem Mosaik kommt hier immer mehr dabei heraus“, sagt Harald Rosmanitz.