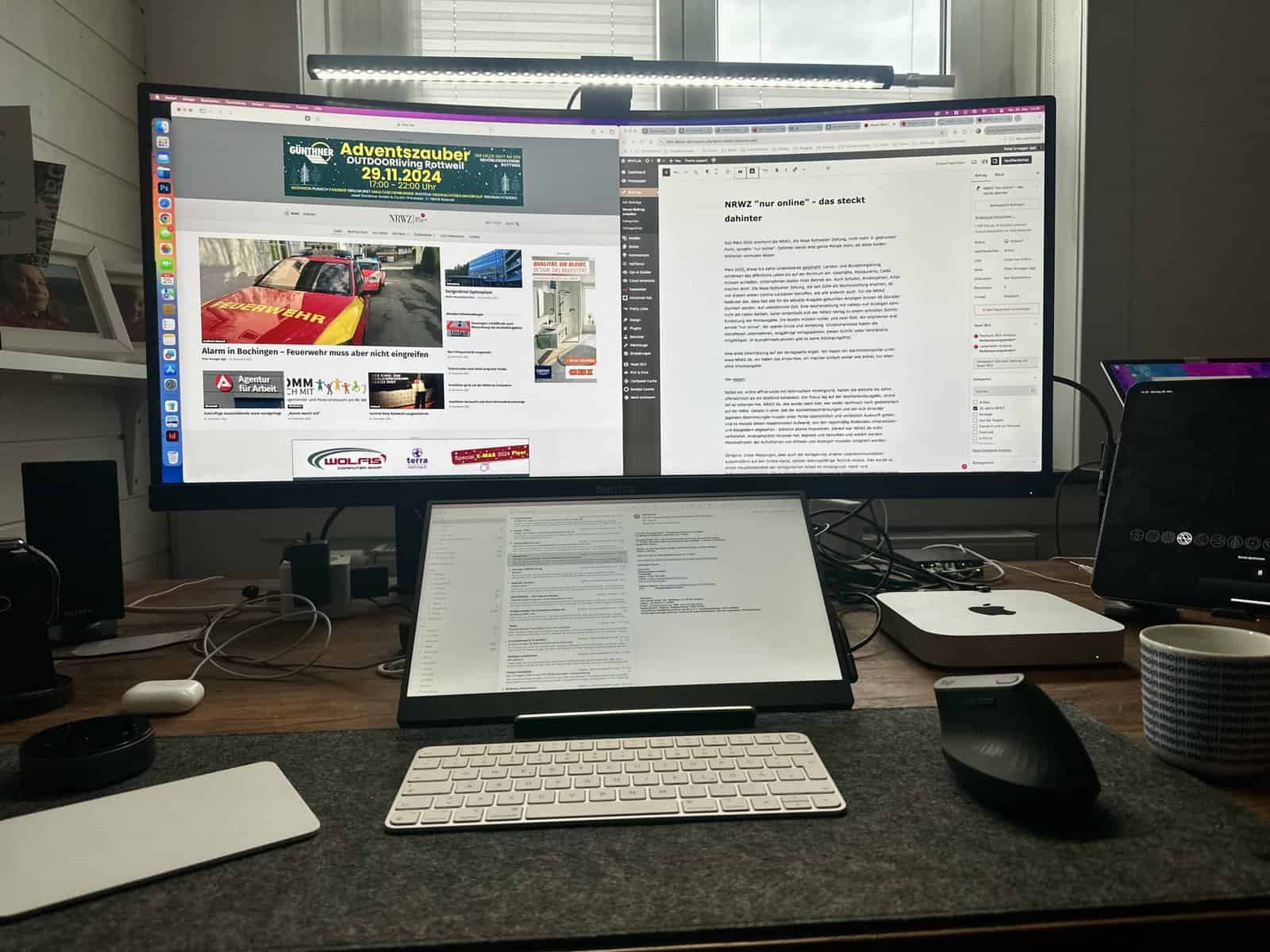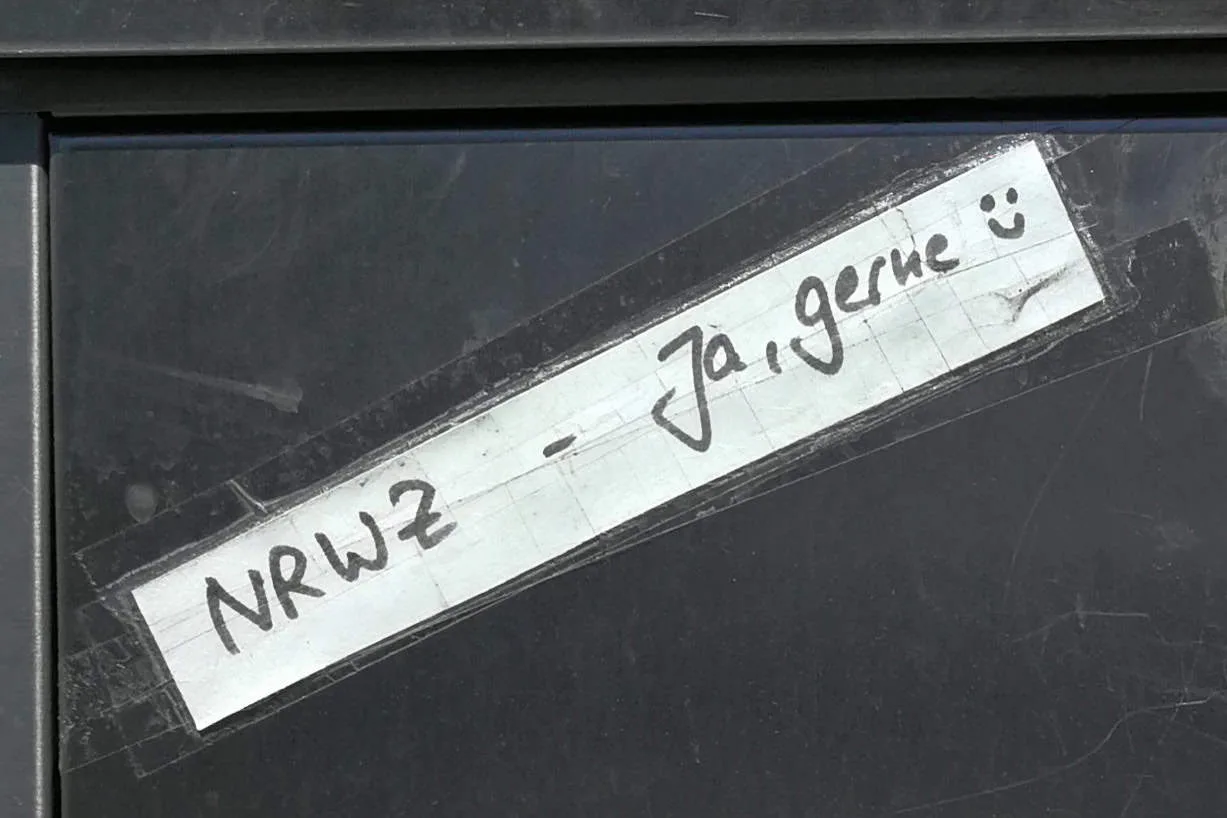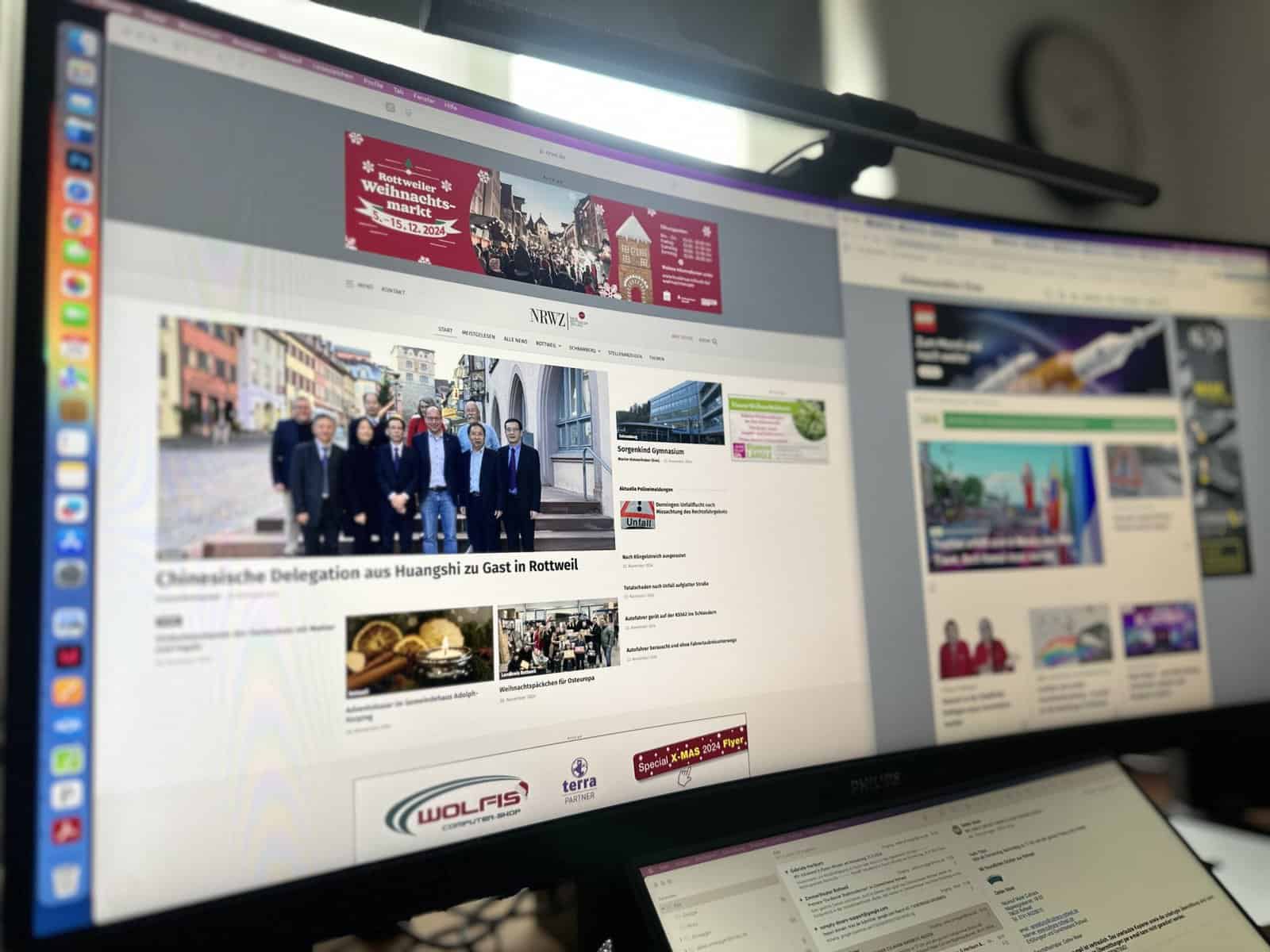„Ich hätte Sie vermutlich für verrückt erklärt!“
Luxusprodukt oder Auslaufmodell? / Ein Gespräch über die Zukunft der Zeitungen

Vielen Zeitungsverlagen weht der Wind ins Gesicht: Auflagen sinken, Inhalte und Anzeigen wandern ins Internet, junge Leser fehlen. Angesichts dieser Tendenzen stellen Medienfachleute bereits im Titel eines Buches zur Pressekrise die polemische Frage: „Wozu noch Zeitungen?“ Der Kommunikationswissenschaftler und Publizist Professor Dr. Stephan Weichert hat den Band mit herausgegeben. Im Gespräch mit der NRWZ erläutert er Risiken und Chancen eines Traditionsmediums in stürmischen Umbruchzeiten.
NRWZ: Herr Weichert, die NRWZ feiert Geburtstag*. Was hätten Sie uns gesagt, wenn wir Ihnen 2004 erzählt hätten, dass wir als Gruppe von Privatleuten eine lokale Wochenzeitung gründen wollen?
Stephan Weichert: Ich hätte Sie vermutlich für verrückt erklärt! Aber nachdem die Wirtschaftskrise das jahrelange System des bedingungslosen Gewinnstrebens großer Verlage und Medienunternehmen aus den Angeln gehoben hat, erscheint mir Ihr Vorgehen nur als konsequenter Schritt in die richtige Richtung.

„Die NRWZ entstand offenbar aus Leidenschaft. Das gefällt mir“,
sagt der Professor für Journalistik an der Macromedia-Hochschule
für Medien und Kommunikation in Hamburg, Dr. Stephan Weichert.
Foto: privat
Angesichts der Wirtschaftskrise zeichnet sich in den USA ein dramatisches Zeitungssterben ab und in Deutschland wird vorsorglich radikal der Rotstift angesetzt. Wo geht es lang mit den Zeitungen?
Eine schwierige Frage, die ich diplomatisch beantworten will: Es wird auch in zehn, 20 Jahren noch Zeitungen geben – aber nur noch als Luxusprodukt für eine immer kleiner werdende Elite, das Bildungsbürgertum. Die breite Masse wird sich noch stärker über Internet-Angebote informieren, und das werden mehrheitlich keine journalistischen Angebote mehr sein.
Die Mehrheit der Nutzer, das zeichnet sich jetzt schon ab, wendet sich wahrscheinlich vom Medium Zeitung ab – aus finanziellen und praktischen Gründen.
Wenn Zeitungen ihre Redaktionen kaputt sparen oder gerade im Lokalen nur noch ein Monopolblatt herrscht, leidet dann nicht die Meinungs- und Willensbildung in einer demokratischen Gesellschaft?
Das ist eine Suggestiv-Frage, die man so nur mit Ja beantworten kann: Natürlich leidet die journalistische Vielfalt, wenn es im Lokalen nur noch einen Platzhirsch gibt. Und dass mit jedem gekündigten Journalisten auch ein Stück Qualität stirbt, leuchtet ebenfalls ein.
Das wichtigere Problem aber ist: Gibt es irgendwann Angebote, die diese Lücke ausmerzen können? Und können solche Angebote im Internet ökonomisch rentabel gedeihen? Ich glaube, das Potenzial gibt, es wird aber noch viel zu wenig genutzt.
In Skandinavien wird die Presse teils staatlich unterstützt. Braucht es Subventionen oder Stiftungsgelder, um einen Qualitätsjournalismus aufrechtzuerhalten?
Stiftungsmodelle sind sicherlich ein guter Weg, um Qualitätsjournalismus zu fördern – weil sie sowohl staats- als auch wirtschaftsfern sind. In New York gibt es Pro Publica, eine unabhängige Redaktion für Recherchejournalismus, die von einer Stiftung finanziert wird. Dieses Modell findet in der amerikanischen Medienlandschaft nach anfänglicher Kritik inzwischen viel Zuspruch: Es hat sich als ein dritter Weg etabliert, durch den die um sich greifenden Sparmaßnahmen – von L.A. Times über Washington Post bis zu New York Times – stellenweise aufgefangen werden können.
Das ist freilich nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Eine ebenso interessante Alternative, die derzeit in den USA diskutiert wird, ist es, Qualitätszeitungen den Status von Bildungseinrichtungen zuzuerkennen, damit diese größere Steuererleichterungen in Anspruch nehmen können.
Im Internet finden sich viele Informationen. Um es zuzuspitzen: Macht das Zeitungen nicht langfristig überflüssig?
Diese Sichtweise ist mir zu einseitig. Natürlich könnte man behaupten, das Internet reiche als Informationskanal völlig aus – dennoch glaube ich an eine Kombination des gedruckten und des digitalen Wortes. Zeitungen bieten immer noch den unschätzbaren Vorteil, ihr Publikum universell zu informieren, sprich: Leser erhalten täglich einen zusammenfassenden Überblick über das, was in der Welt vor sich geht, was für Sie relevant sein könnte – das gilt natürlich noch stärker für Regionalzeitungen als für überregionale Blätter. Die Kommunikationswissenschaft spricht in diesem Zusammenhang von einer „Bereitstellungsqualität“.
Im Internet hingegen – und das gilt nicht minder für journalistische Online-Portale – müssen Sie viel stärker aktiv nach Informationen suchen: Sie müssen also zunächst eine Idee davon entwickeln, was für Sie interessant sein könnte.
Wie können Zeitungen mit Veränderungen durch die digitale Revolution umgehen?
Sie müssen sich den Web-2.0-Umgebungen anpassen. Für einen der wichtigsten Schritte halte ich, den Dialog mit dem Publikum auszubauen: Kommentare von Lesern stärker einbeziehen, mehr Transparenz schaffen, was die eigene journalistische Arbeit angeht, auch Fragen an die Nutzer stellen, sie unmittelbar in Recherchen einbinden. Der Nutzer wird am meisten von der digitalen Revolution profitieren, weil er zum ersten Mal in der Geschichte des Journalismus wirklich ernst genommen wird – die Verlage haben keine andere Wahl.
Blogs und soziale Netzwerken wie Twitter* oder Facebook überschwemmen das Netz mit nutzergenerierten Inhalten. Ist das eine Konkurrenz für den professionellen Journalismus?
All das steht in direkter Konkurrenz zum klassischen Journalismus, vor allem, was das Zeitbudget des täglichen Medienkonsums angeht. Aber auch die Kommunikationsverhältnisse werden in Zukunft noch stärker auf den Kopf gestellt: Informationen kommen über diese Kanäle immer häufiger zu uns Nutzern statt umgekehrt, das auch deshalb, weil soziale Netzwerke in unserer Informationskultur eine größere Rolle spielen – die gesamte Architektur des Netzes baut ja darauf auf.
Twitter* ist ein gutes Beispiel dafür, dass der Nutzer praktisch gar keine journalistischen Portale mehr besuchen muss, wenn er auf bestimmte Links, Artikel, Videos, Blogs aufmerksam werden will – dafür sorgen schon die Leute, deren Tweets ich abonniert habe.
Es ist allerdings auch nicht verwunderlich, dass viele substanzielle Twittermeldungen, Blog- und Facebook-Einträge auf Quellen zurückzuführen sind, die journalistischen Ursprungs sind. Anders gesagt: Ohne professionellen Journalismus wären die Blogosphäre, aber auch die sozialen Netzwerke im Internet um einige Themen ärmer.
Wie sollte gerade der Lokaljournalismus auf diese Umwälzungen reagieren?
Ich sehe gerade hier eine große Chance, auch wenn die Krise viele kleinere Zeitungen hart getroffen hat. Regionale und lokale Angebote haben den unschätzbaren Vorteil, dass sie für das stehen, was die Leute in einer Stadt, einem Kreis besonders schätzen: Orientierung und Glaubwürdigkeit, die wichtigsten Währungen in dem Informationsdurcheinander. Und sie können die Nutzer durch eine direkte Ansprache über Serviceleistungen und die Berichterstattung über kommunale Reizthemen viel stärker an sich binden, als das der großpolitische, überregionale Journalismus kann.
Wird es in 20 Jahren noch Zeitungen geben? Vielleicht sogar auf Papier?
Wie gesagt: Zeitungen auf Papier werden so schnell nicht aussterben, aber es wird in 20 Jahren mit Sicherheit nicht mehr so viele Zeitungen und auch nicht in so hoher Auflage geben. Zeitungsverlage werden für ihre journalistischen Inhalte andere, digitale Vertriebskanäle suchen müssen – und diese auch finden, wenn sie noch kreativer und experimentierfreudiger werden. Dazu gehört vor allem auch die Bereitschaft, ihre Online-Ableger stärker mit den Printredaktionen zu verkoppeln und wieder in Qualitätsinhalte zu investieren.
Was würden Sie uns mit auf den Weg geben: Wie kann die NRWZ die nächsten Jahre erfolgreich bestehen?
Ich glaube, dass kleineren journalistischen Projekten die Zukunft im Netz gehört. Was mir an der NRWZ gefällt ist, dass sie offenbar aus einem Protest gegen ein Angebotsmonopol heraus gegründet wurde. Dazu gehört eine Tugend, die noch Jahrzehnte eine der wichtigsten im Journalismus bleiben wird: Leidenschaft.
Die Fragen stellte unser Redakteur Andreas Linsenmann.
Hinweis: Dieser Text erschien zunächst 2009 in der gedruckten Sonderausgabe „5 Jahre NRWZ!“
* Das Interview erschien 2009. Etwa, bevor aus Twitter im Juli 2023 X wurde.