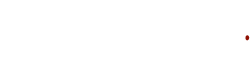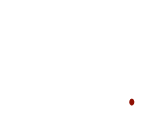„Spannende Jahre“ verspricht der stellvertretende Leiter des Kreisforstamtes Joachim Bea den Schrambergern bei ihrem Wald. Im Ausschuss für Umwelt und Technik hat Bea den Forsteinrichtungsplan für die Jahre von 2026 bis 2036 vorgestellt. Die Hoffnung, mit dem Wald Gewinne machen zu können, hat Bea den Ausschussmitgliedern gleich genommen. Die Probleme des Waldes in der Talstadt würden „den Gesamthaushalt ins Negative ziehen“, fürchtet er.
Schramberg. Alle zehn Jahre ist die sogenannte Forsteinrichtung gesetzlich vorgesehen. Darin seien die grundsätzlichen Ziele für die nächsten zehn Jahre aufgeführt, die der Rat beschließen müsse, so Alexander Mönch von der Abteilung Tiefbau.

Zunächst hatte Bea erläutert, dass auch in den kommenden zehn Jahren die ökonomischen, ökologischen und sozialen Ziele des Waldes gleichwertig betrachtet würden. Leitbild bleibe eine „nachhaltige naturnahe Waldbewirtschaftung“.
Kein Gewinn zu erwarten
Der städtische Wald sei allerdings sehr zerstückelt. Das Tennenbronner Revier sei recht klein. Dann habe man einen großen, wirtschaftlich produktiven Bereich in Waldmössingen und schließlich den Wald um die Talstadt und Sulgen. „Schauen Sie zum Fenster raus“, forderte Bea die Ausschussmitglieder auf. Er zeigte auf die zahlreichen „Dürrständer“, die dort teilweise noch stehen, teilweise bereits umgestürzt im Steilhang liegen. „Der Klimawandel schlägt auf den trockenen Hängen in der Stadt zu.“

Wegen des Rotliegenden und der Hangrutschgefahren sei den Forstleuten ein normales Arbeiten in diesen Bereichen nicht möglich. Das heiße: Helikoptereinsatz. „Das wird den Gesamthaushalt ins Negative ziehen“, fürchtet Bea. Einfach die Bäume stehen und liegen lassen, gehe auch nicht. „Sie haben die Verkehrssicherungspflicht, und das wird sehr teuer werden.“

Ökonomie, Ökologie und Soziales
Bei den ökonomischen Zielen nannte Bea den Waldumbau und Erhalt des Vermögens. Auch wolle man hochwertiges Holz erzeugen. Auch soll der Wald helfen, Ökopunkte für die Stadt zu generieren. Im sozialen Bereich gelte der Generationenvertrag, sprich der Erhalt des Waldes für die künftigen Bürgerinnen und Bürger. Seine Erholungsfunktion zähle dazu, aber auch das Bereitstellen von Holz als Bau- und Brennstoff.
Zu den ökologischen Zielen gehörten laut Bea der Klima-, Boden- und Wasserschutz. Auch möchte man die Baumartenvielfalt erhöhen.
Umstrittener Flächenkauf
In der Diskussion meldete sich Jürgen Kaupp (CDU) mit einer Reihe kritischer Fragen. Ihn störte, dass bei den ökonomischen Zielen davon gesprochen werde, die Stadt werde weitere Waldflächen ankaufen: „Wir werden nicht gefragt?“ Die Stadt habe ein Vorkaufsrecht und prüfe, ob ein Waldstück für die Stadt Sinn mache oder nicht, erklärte Bea. Tiefbauabteilungsleiter Konrad Ginter verwies auf die Wertgrenzen, bis zu denen die Stadtverwaltung selbst entscheiden könne. Er empfinde das, als gebe man der Verwaltung „einen Freibrief“, ärgerte sich Kaupp.
Einmal in Fahrt, störte es ihn, „gewaltig, dass wir als Ziel akzeptieren sollen, dass es keinen Ertrag geben wird.“ Wenn man das schon von vornherein festlege, sei gar kein Anreiz da, doch einen Gewinn zu erreichen. Bea erwiderte, es sei „undenkbar, dass wir in Schramberg Gewinn erwirtschaften.“ Es bringe nichts, etwas anzukündigen, was man nicht schaffen könne.
Zusätzliche Waldflächen kosten viel Geld
Forstrevierleiter Christoph Eberle wurde grundsätzlich: Früher habe die Stadt nicht ohne Grund defizitäre Flächen verkauft. In der Zeit von 2005 bis 2010 habe die Stadt dann große Flächen gekauft. „Die haben wir jetzt an der Backe.“ Zuvor besaß die Stadt in diesem Bereich 60 bis 70 Hektar, heute seien es etwa 200 Hektar. Diese müsse die Stadt bewirtschaften und sei für die Verkehrssicherungspflicht verantwortlich.

Am Beispiel von Sicherungshieben entlang der B 462 nannte er Zahlen. Habe man früher etwa 8000 Euro für eine Ampelsteuerung an der Bundesstraße gezahlt, seien dies heute schon 20.000 Euro. „Es wäre nicht seriös, wenn wir versprechen würden, es gibt ein positives Ergebnis.“
Bewirtschaftungsverbot am Schlossberg
Nach dem Erdrutsch bei der „Schönen Aussicht“ 2012 habe das geologische Landesamt die Hänge am Schlossberg untersucht und ein Bewirtschaftungsverbot für diese Flächen erlassen. Das bedeute, die Forstarbeiter müssen mit Seilen arbeiten. Die Baumstämme müssen per Helikopter rausgeflogen werden. Wegen der Waldbrandgefahr könne man das Holz auch nicht einfach liegen lassen.

Konrad Ginter erinnerte daran, dass die Stadt die Flächen damals „aus gutem Grund“ gekauft hat, um die Landschaft offen zu halten und Luft in die Stadt strömen zu lassen. Man sei sich damals im Rat einig gewesen, dies so zu machen.

Natürliche Verjüngung
Frank Kuner (Aktive Bürger) erkundigte sich, weshalb großflächige Neuanpflanzungen nicht vorgesehen seien. Bea erklärte, das schließe man nicht aus, setze aber in erster Linie auf natürliche Verjüngung. „Wir wollen mit dem leben, was uns die Natur gibt.“ Förster Eberle ergänzte, man müsse Anpflanzungen auch regelmäßig drei bis vier Jahre lang pflegen, freischneiden und eventuell gießen. Aber: „Wo nichts wächst, muss gepflanzt werden.“

Auf Nachfrage von Emil Rode (Freie/Neue Liste) zum Ertrag meinte Förster Eberle provokant: „Ich verbrauche das Geld, das in Waldmössingen erwirtschaftet wird.“ Das könne man so nicht sagen, erwiderte Ginter, beide Reviere hätten eigene Budgets. Er würde gerne auch in Schramberg im Rat den diesen Bereich betreffenden Haushalt vorstellen, ergänzte Bea vom Kreisforstamt. „Das ist in den letzten Jahren nicht geschehen.“
Waldwegebau
Schließlich erkundigte sich Oskar Rapp (Freie/Neue Liste) weshalb im Waldmössinger Wald neue Wege gebaut würden. Da wolle er als Gemeinderat mitreden dürfen. In Waldmössingen gehe es darum, Rückegassen zu befestigen, antwortete Bea. Das seien keine echten Forstwege, sondern Maschinenwege. Wegen des „extrem tonigen Untergrunds“ lasse Förster Jörg Fehrenbacher dort Schotter auf die Strecken werfen.
Andernorts reichten dafür Äste von gefällten Bäumen oder Bodenschutzmatten, warf Rapp ein. Das sei “Standard“, konterte Bea, reiche in Waldmössingen aber nicht aus. Würde man nicht mit Schotter arbeiten, entstünden „riesige Löcher im Wald“. Für die Böden sei der Schotter besser.
Thomas Brugger CDU) erkundigte sich, ob es bei den Arbeiten am Schlossberg und den anderen Hängen im Tal nicht auch andere technische Möglichkeiten als den Hubschraubereinsatz gebe. Bea winkte ab: „Die technischen Möglichkeiten sind begrenzt.“

Bei zwei Enthaltungen stimmte der Ausschuss schließlich zu, dem Rat die Annahme des Forsteinrichtungsplans zu empfehlen. Am 8. Mai wird der Rat dann entscheiden.